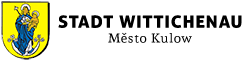Die KRABAT- STELE in Wittichenau
An der nördlichsten Ecke des Marktplatzes von Wittichenau steht die KRABAT-STELE, die ihrer Ausführung vereinfacht und generalisiert ein bisschen wie ein verkürztes Minarett mit 3 Rundbalkonen aussieht und auf dem obersten Balkon einen in bürgerlichen Gewändern des 17. Jahrhunderts gekleideten Mann zeigt, der weder als der bekannte sagenhafte Müllerbursche noch als der kurfürstlich-sächsische Reiterobrist des 17. Jahrhunderts erkennbar ist, aber dennoch den Lausitzer KRABAT als Hauptfigur darstellt.
Er ist auf dem unteren Balkon umgeben von Menschen in unterschiedlichen Gewändern, Trachten und Szenarien. Auf dem mittleren Balkon der Stele befinden sich elf Raben und unter Ihnen neun Kopfbüsten, die in Wechselwirkung mit den neun stilistischen Wappen zu Füßen der Hauptfigur stehen. Ein zwölfter Rabe sitzt auf der rechten Hand der Hauptfigur, deren beider Einheit als eine Art „Doppelverweis“ auf die sorbische Sagengestalt „KRABAT“ verstanden werden kann.
Nur wird die Hauptfigur nicht als islamischer Gebetsrufer verstanden, sondern vielmehr als eine Art Volksheld, der das Christentum mit all seiner Kraft und Macht verteidigt hat. Es handelt sich also nicht um ein Minarett, sondern vielmehr um ein SÄULENMONUMENT, dass in seiner Machart an bestimmte Geschehnisse, Personen und Orte erinnern soll. Zudem wird das SÄULENMONUMENT mit seinen drei Inschriften zur GEDENKSTELE bzw. zu einer EHRENSTELE umfunktioniert.
Der Künstler
Die KRABAT-STELE wurde durch den aus Hohenleipisch stammenden Künstler HANS ALFRED EICKWORTH (*1930 – †1995) zwischen den Jahren 1985 bis 1989 im Auftrag des Büros für architekturbezogene Kunst des Rates des Bezirkes Cottbus für den Marktplatz von Wittichenau aus Anlass des 7. Festival der sorbischen Kultur in Bautzen geschaffen, im Monat Mai des Jahres 1989 aufgestellt und am 05. Juli 1989 durch die Abnahmekommission abgenommen. H.A. Eickworth war nach dem Krieg als Maler und Gewerbegrafiker tätig, qualifizierte sich mit einem Studium bei der Kunsthochschule in Dresden zum Meisterschüler eines bekannten Bildhauers an der Ostberliner Akademie der Künste und wurde nachfolgend freischaffender Künstler in Berlin und später in Hohenleipisch bei Elsterwerda. Der Schwerpunkt seines künstlerischen Schaffens lag in der vom sozialistischen Menschenbild abgeleitete Bildhauerkunst, Freiplastiken und Büsten, die in zahlreichen öffentlichen Räumen ausgestellt wurden.
Die Rundbalkone der Stele
Auf dem untersten Rundbalkon finden wir Menschen aus dem Volke, wie wir sie damals und auch heute noch antreffen können. Es sind Männer, Frauen und Kinder in Alltags-, Arbeits- und Trachtenkleidung, wie sie regional und zeitbezogen in der Lausitz mit Beginn der Neuzeit üblich waren.
Wir erkennen einen einflussreichen Bürger, mag er Lehrer, Verwalter, Richter oder ein Chronist sein, der in seinem Buch Wissenswertes präsentiert oder festhält. Wir erkennen aber auch eine junge Frau mit Kind in einer Tracht, von der man sagen kann, dass sie slawisch ist. Wir erkennen den Müller, der für das verarbeitende Handwerk steht. Zwischen seinen Beinen kann man einen überdimensional großen Hamster mit prall gefüllten Hamsterbacken erkennen, der in dieser Form wohl auch auf verdeckte Eigenschaften des Müllers hinweisen soll. Dann erkennen wir eine mit beiden Beinen im Leben stehende Frau in altdeutscher Tracht oder Kleidung, wie sie von vielen Markt- und Wirtschaftsfrauen getragen wurde. Wir erkennen aber auch ein jugendliches Mädchen bzw. eine Magd, die uns voller Neugierig aufmerksam anschaut, gerade so, als ob sie etwas von uns erwartet. Insgesamt ähnelt diese Personengruppe der Mehrzahl der Bevölkerungsstruktur eines Dorfes, wie wir sie aus jener Zeit kennen.
Die Kleidung und die Trachten, die hier insbesondere die weiblichen Personen tragen, haben einen slawischen Ursprung, ohne dass man sie als typisch sorbisch oder sorbisch regional fest machen könnte. Ihre Kopfhauben, Kopftücher und Rockschürzen widersprechen etwas den typisch sorbischen Trachten, bei denen den Rockschürzen in der Regel keine groben langen Fransen anhängen. Auch die Hauben haben hier eine eher ungewöhnliche sonderbare Form, der die eigentlich übliche Enge der Kopfbedeckung fehlt.
Auf dem mittleren Rundbalkon sehen wir elf Raben, die sehr aufmerksam mit erhobenen Köpfen in alle Richtungen blicken und gerade so erscheinen, als ob sie sich untereinander verständigen. Die unter ihrem Balkon befindlichen neun kleinen Gesichtsskulpturen unterschiedlichen Alters, beschreiben in Wechselwirkung mit den neun stilistischen Wappen unter den Füßen der Hauptfigur die unterschiedlicher Herkunft der scheinbar verknechteten Müllerburschen. Jedoch erkennt man unter ihnen drei vollbärtige und vom Alter gezeichnete Gesichter, die kaum die Gesellen des Müllers darstellen können. Man erkennt hier sogar einen Turbanträger, der aus einer völlig anderen Welt zu kommen scheint.
Wie also kann man diese neun Köpfe und die elf Raben mit der dargestellten Hauptfigur des oberen Rundbalkons oder dem KRABAT-Sagenstoff in Verbindung bringen und was bedeuten letztlich die Inschriften, die in deutscher und in zwei Dialekten der sorbischer Sprache verfasst sind?
Die Zahl des Müllers war die Zwölf, gerade so, wie es auch zwölf Monate des Jahres gibt, in denen sich das Mühlrad der Wassermühle drehen muss. Den zwölften Raben finden wir auf des KRABATs Hand, der auf dem dritten Podest als Hauptfigur der Stele steht. Die Raben zu Füßen der Hauptfigur und auf seiner Hand verdeutlichen die mystische Darstellung der Inhalte der alten Krabat-Sagen, genauso wie sie selbst oft mit dem Tod, der Hexerei oder der schwarzen Magie in Verbindung gebracht werden. Sie waren die Knechte des Schwarzen Müllers, dessen Synonym Schwarz ebenfalls für den Tod, die Hexerei und die schwarze, also böse Magie steht. Zudem steht der Müller festen Fußes und mit erhobenem Kopf als Herr der Raben in der Volksgruppe auf dem unteren Balkon. Er trägt als Einziger den Kopf sicher aufgerichtet und blickt überlegen und sicher gerade so in die Ferne, als ob ihm niemand etwas anhaben könnte. Sogar das kleine links neben ihm stehende Mädchen kuschelt sich ängstlich und festhaltend an seine Mutter. Es sagt uns, dass man sich vor dem Müller oder dieser Art von Mensch in Acht nehmen muss.
Wir sehen auf dem oberen Rundbalkon genau genommen zwei KRABATEN. Einen als Mensch und einen als Raben. So als ob sie eine Verbundenheit als Doppelperson darstellen. Verbunden durch die Heimat, verbunden durch ihr Schicksal und verbunden durch die Sagen. Die Raben stellen das Mystische in den alten Volkssagen dar. Der zwölfte Rabe aber ist Krabat selbst. Er ist unser Krabat, dessen historisches Vorbild der Betteljunge aus Eutrich und der Obrist aus Särchen zugleich ist. Es ist der Krabat der Oberlausitz.

Und die Person des Krabat der nach der Leipziger Kleiderordnung des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit mit einem schmucklosen Mantel und einer einfachen Kappe gekleidet ist und in seiner rechten Hand ein Buch hält, könnte den KRABAT darstellen, der als sorbischer Physikus und Medicus in der Niederlausitz wirkte und dort im 16. Jahrhundert, also ein Jahrhundert früher, als der oberlausitzer KRABAT verehrt wurde. Dieser Krabat verzauberte die einfachen Menschen, als auch die Herrschaften der gehobenen Gesellschaft mit seiner Kunst nach Avicenna, einem persischen Gelehrten des ersten Jahrtausend, den wir ebenfalls auf der STELE finden. Er ist jener Herr mit dem Turban, dessen Herkunft durch dasgerade über ihn befindlichen Wappen mit persischen Schriftzeichen bestätigt wird.
Die Hauptfigur
Die Hauptfigur auf dem oberen Rundbalkon steht also für einen KRABAT, den man in den beiden Lausitzen kannte. Das Gewand des personifizierten KRABAT steht für die ältesten Sagen über den guten Zaubermeister und den Zauberlehrling, ja sogar für den Sorbischen Faustus insgesamt. Giovanni Straparola, ein italienischer Dichter berichtet in seinen Sagen Mitte des 16. Jahrhunderts davon, die erstmals im Deutschen in der Mitte des 16. Jahrhunderts umgesetzt wurden.
Beide KRABATen verdeutlichen in ihrer Einheit und Verschmelzung eine Persönlichkeit unter den Mitmenschen, die uns sagt, dass es trotz aller Verwandlung und Versklavung möglich ist, das Gute zu erkennen und die Versklavung zu beenden, solange man nur daran glaubt.
Selbst die Inschriften bestätigen die doppelte Widmung der Stele, indem sie auf das Glück und des Glückes Träume als Saatgut des edlen sorbischen Herren zum einen und des Zaubermeisters KRABAT zum anderen, verweisen. Der edle sorbische Herr ist der Edelmann Schadowitz und der Zaubermeister ist der Medicus Krabat. Die deutsche Inschrift bestätigt zudem Krabat als sorbischen Volkshelden, also einem Menschen, der den Sorben verbunden war und sein Leben für ihr wohlergehen einsetzte.
Die Inschriften der Stele
Die Inschrift oben lautet: „Dem Sorbischen Volkshelden Krabat“, darunter: „Hona zboža wusych – wusych zboža sony. – J.B. Kulow“ bedeutet aus dem Obersorbischen übersetzt: „Ein Feld mit Glück hab ich gesät, gesät des Glückes Träume – Jurij Brĕzan – Wittichenau“.
Unten steht: Dušny serbski Guslowar H. & MEJSTAŘ KRABAT“ bedeutet aus dem Niedersorbischen übersetzt: „ Dem edlen sorbischen Herrn & Zaubermeister KRABAT“.
Die Deutung der Stele als Erinnerungselement
Und die Stele selbst ist mehr als nur ein Säulenmonument. Als GEDENKSTELE verweist sie zugleich auch auf ein Sinnbild der damaligen Militärgrenze zwischen dem Osmanischen und Christlichen Reich, welches als Wachturm gedeutet werden kann. KRABAT wacht als Beschützer über die Seinen, so wie sie es zu ihrer Zeit auch an der Militärgrenze in Kroatien taten. Und kroatische Elemente finden wir auch in den slawischen Trachten der Stele. Die Fransenschürzen und die Kopfbedeckungen der Frauen sind auch Bestandteile dortiger Trachten.
Die neun Wappen und neun Personen der zweiten und dritten Ebene sind in Verbindung zu sehen. Das bestätigt auch die vermutliche Selbstdarstellung des Künstlers als Büste unter dem Wappen der Elster – für Elsterwerda.
Die Stele ist also eine gesamtlausitzer Stele, die an die sagenhaften und wahren KRABATEN der LAUSITZ gleichermaßen erinnern soll. Sie ist einzigartig und damit einmalig. Sie geht weit über Ihre Erinnerungsfunktion voraus, indem sie uns ständig einen Spiegel vorhält und uns lehrt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Sie sagt uns, dass es an uns selbst liegt, Glück, Freiheit und Gerechtigkeit zu verwirklichen. Der Geist der guten KRABATEN bleibt damit für immer und ewig am Leben. KRABAT ist die Quelle und die Kraft des Guten.